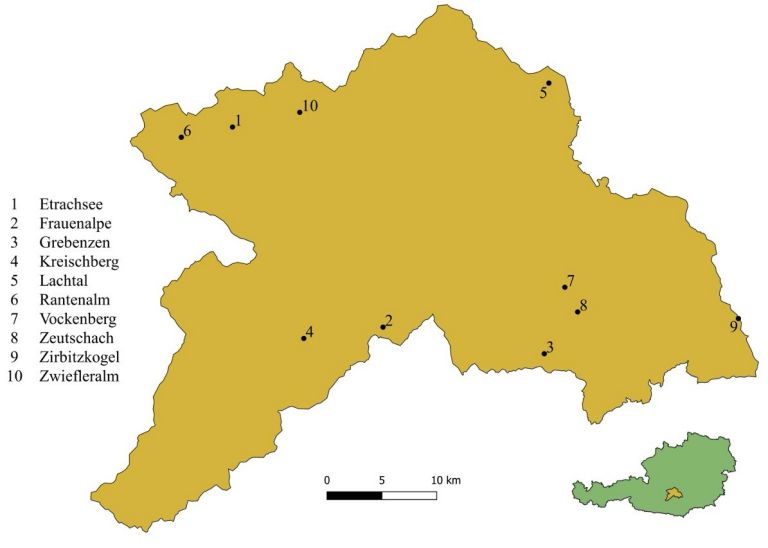Keywords: knowledge exchange, forest history, Japan, Austria, 19th century
Available at https://doi.org/10.53203/fs.2301.3
See below the issue 1/2023 as E-Paper or have a look at our E-Paper archive dating back to 1955.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Zusammenfassung
Österreich und Japan gelten als waldreiche Nationen mit einer langen forstlichen Tradition. Aktuell finden z. B. gegenseitige Konsultation von Forstexperten oder Besuche japanischer Forstunternehmer auf Fachmessen wie der Austrofoma großen Anklang. Jedoch kaum analysiert wurde im forsthistorischen Diskurs bislang der Ausgangspunkt dieses internationalen Austausches zu forstlichem Wissen. Entlang der Methodik zur Wissenszirkulation und zur historischen Biographieforschung lässt sich diese Lücke schließen, indem frühe Wegmarken des Austausches identifiziert und untersucht werden.
Der Austausch zu forstlichen Themen zwischen Österreich und Japan begann bereits in den 1860er- und 1870er-Jahren. Wichtige historische Ereignisse wie die k. k. Ostasienexpedition von 1868 sowie die Weltausstellung in Wien 1873 stellen dabei zentrale Wegmarken dar. Diese ermöglichten die Entstehung personeller Wissensnetzwerke, ausgehend von den Persönlichkeiten Wilhelm Exner und Gustav Marchet sowie Tsunetami Sano und Dohei Ôgata als die wesentlichen Vermittlerfiguren. Wissen über die Forstwirtschaft und -wissenschaft sowie die Holzindustrie wurde z. B. durch den Besuch des forstlichen Ausstellungsteils der Weltausstellung in Wien oder die Teilnahme an forstwissenschaftlichen Vorträgen und Vorlesungen vermittelt. In Japan hatte dies Einfluss auf die Reform der Forstverwaltung und die Entstehung erster forstlicher Vereinigungen bis zu Beginn der 1880er-Jahre. Hiernach schwand der österreichische Einfluss und zunehmend gelangte nun die Forstwirtschaft Deutschlands in den Fokus Japans.
Abstract
Austria and Japan are considered to be forest-rich nations with a long forestry tradition. Currently, mutual consultations of forestry experts or visits of Japanese forestry experts to trade fairs such as Austrofoma are very popular. However, the starting point of this international exchange of forest knowledge has hardly been analysed in the discourse on forest history. Using the methodology of knowledge circulation and historical biographical research, this gap can be closed by attempting to identify and examine early milestones of the exchange.
The exchange on forestry topics between Austria and Japan began as early as the 1860s and -70s. Important historical events such as the Imperial East Asia Expedition of 1868 and the World's Fair in Vienna in 1873 represent central milestones. These enabled the emergence of personal knowledge networks, starting with Wilhelm Exner and Gustav Marchet as well as Tsunetami Sano and Dohei Ôgata as key persons. Knowledge about forestry and forest science as well as the timber industry was mutually shared e.g. by visiting the forestry section of the world fair or attending forestry lectures. In Japan, this initially had an influence on the reform of the forest administration and the emergence of the first forestry associations until the beginning of the 1880s. After this, Austrian influence waned and the focus of Japan increasingly shifted to German forestry.
1 Einleitung
Der internationale Austausch zu forstlichem Wissen ist heute gerade auch mit Blick auf die globalen Herausforderungen wie die Klimaveränderung oder die internationalen Handels- und Verwertungsströme von großer Bedeutung. Die IUFRO (International Union of Forest Research Organisations), konstituiert 1892 in Eberswalde durch die Staaten Deutschland, Österreich und die Schweiz und mit heutigem Sitz in Wien, vernetzt seit über 130 Jahren Forstwissenschaftler aus aller Welt und unterstützt institutionell den internationalen Dialog zu forstlichen Themen (JOHANN et al. 2017). Japan, als erste asiatische Nation, wurde anlässlich der IV. Verbandstagung 1903 in Mariabrunn durch den Direktor der Versuchsanstalt Josef Friedrich (1845–1909) zur Mitgliedschaft eingeladen (JACAR A15113482500) und trat dem internationalen Verband bei. Diese Einladung kann als Anerkennung des in kurzer Zeit erreichten, hohen forstwissenschaftlichen Niveaus Japans verstanden werden (vgl. LORENZ-LIBURNAU 1896). Eine forstakademische, universitäre Ausbildung entstand mit der Eingliederung der Landwirtschafts- und Forstakademie Tokio, der tôkyô nôrin gakkô, als Landwirtschaftliche Fakultät der Kaiserlichen Universität Tokio erst 1891. Als Professor für Wildbachverbauung war dort von 1905 bis 1909 der k.k. Oberforstkommisär Amerigo Hofmann (1875–1947) tätig, der durch seine zahlreichen Veröffentlichungen, z. B. in der Österreichischen Forst-Zeitung (ÖFZ), und sein Buch „Aus den Waldungen des fernen Ostens“ Japan als Waldland sowohl der forstfachlichen als auch der öffentlichen Leserschaft in Österreich bekannt machte (NFP 1913, HOFMANN 1913).
Dieses bedeutende Engagement von Hofmann wurde in einigen Arbeiten ausführlich behandelt (KREINER 1976, AULITZKY 1984, NISHIMOTO 2018) und stellt den bislang sichtbarsten Teil der frühen forstlichen Wissenszirkulation zwischen Österreich und Japan dar.
Tatsächlich weist der internationale Austausch zu forstlichem Wissen mit Japan jedoch eine noch ältere Tradition auf. Von Seiten Österreichs zeigt sich dies bereits in den 1860er Jahren zunächst an einem forstspezifischen Interesse an Exoten zum Anbau in Österreich sowie an der Suche nach neuen Absatzmärkten für die heimischen Forst- und Holzprodukte bzw. -technologien (SCHERZER 1872). Diese Phase ab der Öffnung Japans bis zur Berufung Hofmanns 1904 hat jedoch im forsthistorischen Diskurs bislang nur wenig Beachtung gefunden. Gerade dieser Zeitraum und mit ihm die Vorreiter Hofmanns können jedoch eine Erklärung für ein bereits existierendes Netzwerk japanischer und österreichischer Forstexperten liefern und Verständnis dafür schaffen, wie es zu der Berufung eines österreichischen Forstingenieurs auf den Lehrstuhl für Wildbachverbauung in Japan kommen konnte. Inokuma (1966) sowie Nagaike (1975a und 1975b) haben zwar Arbeiten zu den japanischen Vermittlerfiguren zu Beginn des Austausches vorgelegt, doch fehlt hierbei die ergänzende und relevante Analyse aus der europäischen Perspektive. Um diese Wissenslücke zu schließen, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Fragen:
1. Welche Ereignisse lassen sich als zentrale Wegmarken für den Beginn der forstlichen Wissenszirkulation ausmachen?
2. Wer waren die relevanten japanischen Vermittlerfiguren, die den Austausch initiierten und was zeichnete sie aus?
3. Welches Wissen um die Forst- und Waldwirtschaft zirkulierte in diesem Zeitraum und wurde auf welche Weise auch in den Zielländern in Expertenkreisen oder in der Öffentlichkeit verbreitet?
2 Methodik und Quellen
Die vorliegende Arbeit wurde entlang der Methodik zur Untersuchung der Zirkulation von Wissen (vgl. LIGHTMAN et al. 2013) erstellt und analysiert anhand der verfügbaren Quellen die Vermittlung von Wissen im Kontext von Zeit (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts), Raum (Japan und Österreich) und Thematik (Forstwissenschaft). So gelingt es, Personen und Institutionen zu identifizieren und in die o. g. Zusammenhänge zu stellen (SARASIN 2011). Nach SARASIN zielt diese Art der Analyse von Wissensvermittlung vor allem darauf ab, Effekte, Träger und Zusammenhänge darzustellen. Ergänzend liefert die Historische Biographieforschung (DEPKAT 2014, LECKIE 2004) wichtige Erkenntnisse zu den handelnden Personen und erlaubt es unter anderem, die Biographie der identifizierten Personen entlang des für die Zirkulation relevanten biographischen Teils zu verdichten (ETZELMÜLLER 2012, SCHWEIGER 2009). LÜSEBRINK spricht hier auch von Vermittlerfiguren, die die Wege innerhalb eines Kulturtransfers mittels verfügbarer Medien nachvollziehbar machen. Auch liefert er in seinem Konzept zum Kulturtransfer eine Antwort auf die Frage nach der Motivation der Beteiligten und unterteilt diese in 1. Ökonomisches Interesse, 2. Politische Zielsetzungen und 3. Emotionale, affektive Faktoren (LÜSEBRINK 2001).
Zentrale historische Ereignisse für die Entstehung und Entwicklung des Austausches zwischen Japan und Österreich, wie z. B. die Ostasienexpedition 1868 oder die Wiener Weltausstellung 1873, werden mit Blick auf die forstliche Relevanz hin analysiert und als Wegmarken der forstlichen Wissenszirkulation aufgezeigt. Wegmarken sollen demnach als größere Ereignisse verstanden werden, die über einen längeren Zeitraum anhalten, eine Vielzahl von Personen und Einzelereignissen beinhalten und somit einen umfänglicheren Entwicklungsschritt oder Wendepunkt einleiten.
Die verwendeten Quellen stammen überwiegend aus forstlichen Fachzeitschriften und Tageszeitungen des untersuchten Zeitraums sowie aus Archiven von Ministerien und Universitäten. Vor allem sind die Österreichische Forst-Zeitung (ÖFZ) und das Centralblatt für das gesamte Forstwesen (CbfdgFw) sowie die sanrin, das Journal des Japanischen Forstvereins, besonders relevante Quellen, die oftmals in digitalisierter Form als Literatur auch im Internet abgefragt werden können, z. B. bei https://anno.onb.ac.at. Offizielle Berichte der beteiligten österreichischen und japanischen Ministerien, z. B. der Expeditionsbericht zur k. k. Expedition nach Ostasien, Berichte über die Weltausstellung in Wien etc., liefern zahlreiche Belege für den forstlichen Wissensaustausch. Anhand der Matrikellisten der BOKU lassen sich bspw. zudem die zahlreichen japanischen Studierenden und die von Ihnen besuchten Vorlesungen nachweisen.
3 Ergebnisse
3.1 Zentrale Wegmarken der frühen forstlichen Wissenszirkulation
Bereits ab Mitte der 1870er-Jahre finden sich in Japan erste Schriften zur Österreichischen Forstwirtschaft, darunter z. B. die Übersetzung des Österreichischen Forstgesetzes von 1852 (vgl. SYRUCZEK 1853). Eine Sammlung von Übersetzungen und Kommentaren wurde 1875 im Bericht der japanischen Ausstellungskommission zur Wiener Weltausstellung ôkoku tenrankai hôkokushô sanrinbu (Bericht zur Ausstellung in Österreich – Teil zur Waldwirtschaft) veröffentlicht (ÔGATA 1875). Es bestand demnach bereits gegen Mitte der 1870er-Jahre ein Wissensaustausch zu forstlichen Themen zwischen Österreich und Japan, z. B. über exotische Baumarten oder Holzverarbeitungsmethoden sowie die Forstgesetzgebung und Forstadministration. Anhand ausgewählter Wegmarken lässt sich dieser anfängliche forstliche Austausch nachzeichnen und verdeutlicht, dass zum Zeitpunkt der Berufung von Hofmann 1904 (ÖFZ 1904) bereits ein forstliches Wissensnetzwerk etabliert war.
Die k. u. k. Ostasienexpedition von 1868 nach China, Siam und Japan
Eine erste Wegmarke im forstlichen Wissensaustausch stellt die Entsendung der k. u. k. (kaiserlich und königlichen) Ostasienexpedition 1868 nach Fernost dar. Nach der 1854 durch die amerikanische Flotte unter Commander Perry erzwungenen Öffnung Japans, entsandten weitere westliche Mächte Expeditionen nach Japan (z. B. die Preußische Ostasienexpedition 1859-1862) und schlossen dort Freundschafts- und Handelsverträge ab (STAHNCKE 2000). Österreich-Ungarn bewilligte erst 1868 die Durchführung einer solchen Expedition, die neben Japan auch China und Siam zum Ziel hatte (SCHERZER 1872). Die politische Delegation wurde von Fachleuten begleitet, für die Land- und Forstwirtschaft war dies der Zoologe Szymon Syrski. Wenngleich dessen Hauptaugenmerk auf der Landwirtschaft der besuchten Länder lag, so ist sein kurzer Abriss über die Forstwirtschaft Japans der bislang erste bekannte Beitrag dieser Art in einer österreichischen Schrift (SYRSKI 1872). Die Instruktionen für die fachmännischen Begleiter hatten tatsächlich ausdrücklich auch forstliche Anforderungen beinhaltet, z. B. den Auftrag zur Suche nach passenden Bäumen und nach Absatzmärkten für die österreichische Holzindustrie: „Der Wald und seine Produkte spielen in unserer Volkswirthschaft eine so hervorragende Rolle, dass die ostasiatische Expedition auch zu diesem Zwecke benützt werden sollte“ und „Die von der Expedition berührten Länder können Waldbäume enthalten, welche möglicher Weise (weil sie bei uns ähnliches Klima fänden) auch in Österreich gedeihen würden. Von diesen Baumarten wären Samen, allenfalls auch Pflanzen, und die Notizen über ihr Wesen mitzubringen“ (SCHERZER 1872, 412-413).
Neben der rudimentären Schilderung der Forstwirtschaft durch Syrski, gelangte zunächst jedoch vor allem Wissen über die Holzindustrie Japans nach Österreich. Wilhelm Exner (1840–1931), Professor für forstliches Ingenieurwesen an der Forstakademie Mariabrunn und später der Hochschule für Bodenkultur (BOKU), hatte den fachmännischen Exkursionsbegleiter Artur Scala beauftragt, in Ostasien Holzprodukte, Holzmuster und Werkzeuge zur mechanischen Holzbearbeitung für die Forstakademie Mariabrunn zu sammeln. Exner veröffentlichte dazu eine größere Arbeit in der Sammlung der Fachmännischen Berichte über die österreich-ungarische Expedition (EXNER 1872). Die Sammlung japanischer Werkzeuge war auch der Anlass des ersten Besuches des japanischen Ministerresidenten Sano an der Forstakademie Mariabrunn im August 1873 (IAZ 1873b). Teile der Sammlung befinden sich heute im Welt-Museum in Wien. Exners Vortrag zur Holzindustrie Japans im Orientalischen Museum Wien Anfang 1881 wurde später in der „Monatsschrift für den Orient“ veröffentlicht und lieferte einen breiteren Blick auf Japan als Holznation (EXNER 1881a). Ähnliche Arbeiten zur Holzverwendung in Japan lassen sich zu diesem frühen Zeitpunkt alleine bei DUPONT (1880) oder REIN (1881) finden. Exner zitierte darin die offiziellen Angaben zur japanischen Forstwirtschaft, die im Ausstellungsbericht zur Weltausstellung in Paris 1878 durch die japanische Kommission veröffentlicht worden waren, doch stellte er auch Ergebnisse seiner eigenen Forschungen vor, die er an japanischen Hölzern und Werkzeugen vorgenommen hatte: „Die japanische Holzindustrie ist schon nach mancher Richtung als die erste in der Welt zu betrachten und wir von unserem Standpunkte können dieses betriebsame, erfinderische und gewissenhafte Volk nur bewundern“ (EXNER 1881c, S. 119). Aus dem Beitrag geht ebenfalls hervor, dass Exner Versuche mit japanischen Hölzern veranlasst hatte, um deren Qualität hinsichtlich z. B. Festigkeit und Elastizität zu analysieren (EXNER 1881b). Auch liefert der Bericht den Beleg nicht nur für forstliche Wissenszirkulation, sondern für einen regelrechten Technologietransfer: „Das technologische Gewerbe-Museum in Wien hat der Firma Vogel & Noot den japanischen Querschnitt-Fuchsschwanz nachbauen lassen und die Exemplare, welche bereits in unseren Werkstätten Eingang fanden, sind Lieblinge der Arbeiter geworden“ (EXNER 1881c, S. 118). Exner hatte folglich erheblichen Anteil daran, dass Wissen über die japanische Holz-Industrie in Österreich anlangte.
Ein weiteres Mitglied der Expedition nach Fernost war Baron Heinrich von Calice (1831-1912), der von Shanghai aus als Generalbevollmächtigter für Ostasien Österreich auch in Japan vertrat. Er führte ab 1871 direkte Gespräche mit der neuen japanischen Regierung und verhandelte die Teilnahme Japans an der Weltausstellung in Wien 1873 (PANTZER 1973).
Die Weltausstellung in Wien 1873
Die Weltausstellung in Wien, die am 01. Mai 1873 anlässlich des 25. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs eröffnet wurde, stellt die zweite zentrale Wegmarke für den frühen Austausch zu forstlichem Wissen dar. Bereits zuvor hatten sich einzelne japanische Aussteller an den Weltausstellungen 1862 in London und 1867 in Paris beteiligt. Nach der Meiji-Restauration von 1868 bot sich für die neue japanische Regierung nun erstmals die Gelegenheit, sich als geeinte Nation zu präsentieren (HEDINGER 2011; SAKAMOTO 2007). Baron Calice überreichte im Januar 1872 anlässlich einer Audienz am Kaiserhof dem Tennô die offizielle Einladung zur Teilnahme an der Weltausstellung in Wien (CIJ 1873). Nach anfänglichem Zögern konnte Calice die japanischen Regierungsvertreter von den Möglichkeiten und Vorteilen einer Teilnahme überzeugen. Kurz darauf wurde eine Ausstellungskommission bestellt, der u. a. die Vizeminister des Äußeren sowie der Finanzen vorsaßen. Diese Besetzung zeigt die hohe politische Bedeutung und Erwartungen an eine Beteiligung. Für die Organisation wurde ein Büro für Ausstellungsangelegenheiten eingerichtet, zugleich folgte ein landesweiter Aufruf zur Einsendung von Ausstellungsexponaten. Die Sammlung, die in Umfang und Qualität sehr bedeutend war, wurde vor der Verschiffung nach Europa im Dezember 1872 in Tokio der Öffentlichkeit präsentiert (PANTZER 1973; HEDINGER 2011). Die Österreichische Nationalbibliothek verwahrt in ihrem Archiv ein Fotoalbum des Ausseer Fotografen Michael Moser (1853–1912), der diese Ausstellung und die Exponate in Tokio fotografierte (MOSER 1872). Moser war von der japanischen Regierung als Dolmetscher für die Weltausstellung engagiert worden. Mit der Berufung des Vizeministers für öffentliche Arbeiten Tsunetami Sano (1822–1902) zum Direktor der Ausstellungskommission wurde eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. Unter der rund 80-köpfigen Delegation befanden sich zahlreiche Beamte, Fachleute und Handwerker, darunter auch der als Dolmetscher engagierte Dohei Ôgata, der im Anschluss an die Weltausstellung an der Forstakademie Mariabrunn zum Studium verblieb.
Die Forstwirtschaft nahm bei der Wiener Weltausstellung, wie zuvor schon 1867 in Paris, mit einer eigenen Sektion einen bedeutenden Raum ein, für die Holzindustrie wurde sogar erstmals eine eigene Gruppe geschaffen, „Gruppe VIII. Holz-Industrie“ (JUDEICH 1874). Vor allem Österreich-Ungarn präsentierte seinen wichtigen Industriezweig in Form einer großen Leistungsschau (vgl. IAZ 1873a). Wenngleich Japan keinen eigenständigen forstlichen Beitrag brachte, so wurden doch in verschiedenen Ausstellungsgruppen Exponate mit forstlichem Charakter angemeldet und ausgestellt (Tabelle 1, z. B. in „Gruppe II. Landwirthschaft, Forstwirthschaft, Wein, Obstbau und Gartenbau“ u. a. Rinde von Magnolia hypoleuca, Hölzer von Sophora japonica oder Juniperus rigida, weiter wurden rund 170 Holzproben (z. B. Taxus cuspidata, Torreya nucifera, Thuyopsis dolobrata etc.) gezeigt: „Die ausgestellte Holzsammlung war eine reichhaltige. Die Muster waren in Bretterform, welche in den meisten Fällen eine Länge von 4-5 Fuss hatten“ (ANTOINE 1876a, S. 243). Auch die für Japan typische Holzkohle und Asche für die Porzellanglasur wurden als „verschiedene Forstproducte“ präsentiert. Die Holzindustrie fand ebenfalls Berücksichtigung und es kamen Möbel und Tischlerarbeiten japanischer Manufakturen zur Schau, aber auch Drechslerarbeiten und Schnitzereien. Sie veranschaulichten dadurch, dass Japan eine reiche forstliche Flora aufwies und diesen Reichtum auch zu verwerten verstand (JAC 1873; ANTOINE 1876b). Allerdings fanden die Einreichungen aus Japan in der österreichischen forstlichen Rezension keine Berücksichtigung (MICKLITZ 1874), wenngleich die internationale Jury in der Kategorie „VIII. Holz-Industrie“ rund 20 Fortschritts- und Verdienstmedaillen an japanische Aussteller vergeben hatte (GD 1873b).
Alleine bei Exner, Mitglied der Internationalen Jury in der Gruppe VIII (Holz-Industrie), findet sich ein Hinweis auf die von Japan ausgestellten Handsägen (s. o.) (EXNER 1874). Im offiziellen Bericht der Deutschen Regierung hingegen wurde Japan zumindest in einigen forstlichen Aspekten erwähnt, z. B. die Darstellung der Gewinnung des japanischen Lackes aus Rhus vernicifera oder das gezeigte Herbarium etc.: „Nach Allem erregte die Ausstellung Japans also auch in forstlicher Beziehung die gerechte Aufmerksamkeit, obgleich es nicht möglich war, Aufschlüsse über etwaige Forstwirthschaft dieses Landes selbst zu erlangen“ (JUDEICH 1874, S. 746). Einen umfassenderen Einblick in den forstbotanischen Beitrag Japans lieferte ZWANZIGER: „Von Hölzern lagen unter andern vor große Bretter von der japanischen Ceder, Tschinoki, Cryptomeria Japonica, mit wohlriechendem Holze und breiten Jahresringen, aus dem auch der Tempel im Gärtchen bis zu den kleinen Dachschindelchen gebaut war“ (ZWANZIGER 1874, S. 296) (Abb. 1).

Abbildung 1: Japanischer Tempel, erbaut für die Weltausstellung 1873.
Figure 1: Japanese Shintô shrine, constructed for the World´s Fair in Vienna 1873.
Quelle: Michael Frankenstein & Comp. (Fotoatelier), Wiener Photographen-Association (Verlag), Weltausstellung 1873: Japanische Gartenanlagen (Nr. 1462), 1873, Wien Museum Inv.-Nr. 174005/86, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/343954/)
Japan vermittelte demnach erfolgreich seinen gerechtfertigten Ruf als Wald- und Holznation, wenngleich der Entwicklungsstand sowohl bei der Forstverwaltung als auch bei den Forstwissenschaften noch nicht auf einem mit dem Westen vergleichbaren Niveau festzustellen war. Eine eigenständige Forstabteilung entstand mit dem sanrin kyoku (Forstbüro) erstmals 1879 beim Innenministerium und die erste Forstakademie, die sanrin gakkô, wurde erst 1882 im Tokioter Vorort Nishihagara gegründet.
Der erste internationale Kongress für Land- und Forstwirthe 1873
Parallel zur Weltausstellung fanden in Wien zahlreiche internationale Fachkongresse statt. Das österreichische Ackerbauministerium unter Ackerbauminister Johann von Chlumecky (1834–1924) hatte frühzeitig mit der Planung und Organisation eines internationalen Kongresses begonnen, den die Veranstalter der Weltausstellung als ersten internationalen Kongress der Forst- und Landwirte vom 19.–25.09.1873 in Wien ausrichteten. Hierzu kamen rund 300 internationale Teilnehmer zusammen, um über internationale Standards bei der Behandlung forstlicher Fragen zu verhandeln, z. B. „Welche internationalen Vereinbarungen erscheinen nothwendig, um der fortschreitenden Verwüstung der Wälder entgegen zu treten?“ (WWZ 1873; FISCHBACH 1874). Japan nahm ebenfalls an diesem Forstkongress teil und wurde durch den Kommissionsleiter Sano sowie die deutschen Delegationsmitglieder Dr. Gottfried Wagener und Heinrich von Siebold, ein Sohn des großen Japanforschers Philipp Franz von Siebold, vertreten. Auf der Teilnehmerliste finden sich nahezu sämtliche bedeutenden Persönlichkeiten der Forstwissenschaften jener Zeit wie z. B. die Österreicher Wiesener, Seckendorff, Marchet, die Deutschen Hartig, Judeich, Nördlinger, Hess, Ebermayer und der Schweizer Landolt (CLF 1874). Durch den wissenschaftlichen Diskurs zu drängenden, internationalen Themen, konnte Sano ein tieferes Verständnis für forstliche Zeitfragen entwickeln. LOTZ (2018) kommt in seiner Bewertung der Wirkkraft dieses Kongresses zu einem differenzierten Urteil. So sei es nur in Teilen gelungen, die zahlreichen Beschlüsse in konkrete Forderungen zu übersetzen und diese durchzusetzen. Vor allem aber wurde ein wichtiges Ziel noch nicht erreicht, nämlich die Einsetzung einer dauerhaften Kommission für ein international harmonisiertes Versuchswesen. Dies sollte erst durch die Gründung des Internationalen Verbandes der forstlichen Versuchsstationen in 1892 in Eberswalde realisiert werden (FRIEDRICH 1893), welchem Japan schließlich 1903 als erste asiatische Nation beitrat. Wenngleich Japan 1873 noch außer Stande war sich an einem breiteren, forstwissenschaftlichen Diskurs zu beteiligen, so kann die erste Teilnahme an einem internationalen forstlichen Kongress ebenfalls als relevante Wegmarke bezeichnet werden. Eine Forstwissenschaft im europäischen Sinne war noch nicht etabliert, sondern nahm diese erst durch die Gründung der Forstpflanzenschule in Nishigahara 1878, aus der 1882 die erste Forstakademie in Japan hervorging, ihren Anfang. Gerade aber diese frühe Teilnahme an einem wissenschaftlichen Kongress dürfte einen zusätzlichen Impuls gegeben haben, nicht nur die Forstwirtschaft sondern in gleichem Maße die Forstwissenschaft in Japan staatlicherseits voranzutreiben.
3.2 Vermittlerfiguren im japanisch-österreichischen Wissensaustauschs
Die zentralen Wegmarken des Austausches waren mit Akteuren verbunden, die einen wesentlichen Anteil an deren Entstehung sowie an den weiterführenden Pfaden hatten. Im Fall der Weltausstellung waren dies die Japaner Tsunetami Sano und Dohei Ôgata und auf österreichischer Seite vor allem die zu der Zeit an der Forstakademie Mariabrunn wirkenden Professoren Wilhelm Exner und Gustav Marchet. Exner, der sich auf Grund seiner fachlichen Expertise insbesondere für die japanische Holzindustrie und -technologie interessierte und Marchet, da sich dieser den Japanern als zentrale Ansprechperson in forstlichen Fragen anbot.
Für Japan war der forstliche Wissenserwerb von großer Wichtigkeit, das aktive, strategische Vorgehen Sanos und die Ausbildung Ôgatas an der Forstakademie hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Modernisierung und Entwicklung der Forstwirtschaft in Japan. Ein tieferes Interesse Österreichs an der japanischen Forstwirtschaft ist für diesen frühen Zeitraum nicht feststellbar. Da zudem die Rollen von Exner und Marchet in der Literatur bereits umfassend gewürdigt wurden (vgl. EXNER 1929; ÖFZ 1916), bedarf es hier keiner weitergehenden biographischen Darstellung.
Tsunetami Sano (1823–1902)
Tsunetami Sano (Abb. 2) entstammte einem Samurai-Clan aus dem Lehen Saga (Saga-han) und hatte bereits durch seine Teilnahme an der Weltausstellung in Paris 1867 erste Erfahrungen bei der Durchführung einer internationalen Ausstellungsbeteiligung gewinnen können. Zudem hatte er für die japanische Regierung den Bau von Kriegsschiffen in einem holländischen Arsenal verhandelt und war vertraut mit den europäischen Sitten (LANMAN 1883) als er 1872 zum stellvertretenden Kommissionspräsidenten und zum Ministerresidenten Japans für Österreich und Italien bestellt wurde. Er traf im April 1873 in Wien ein (WZ 1873). Die Japanische Delegation konnte sich durch die forstliche Leistungsschau Österreich-Ungarns ein Bild davon machen, auf welch fortgeschrittenem Niveau sich die Holzindustrie und die Forstwissenschaft in Österreich befanden. Sano identifizierte die Forstwirtschaft als relevantes Thema des Wissensaustausches (INOKUMA 1966). Wilhelm Exner betont in seinen Memoiren die besondere Rolle von Sano als Direktor des japanischen Ausstellungsbeitrags (EXNER 1929). Sano kam wiederholt zu Gesprächen mit österreichischen Forstwissenschaftlern, z. B. Gustav Marchet, zusammen und besuchte u. a. die Forstakademie Mariabrunn wenigstens zweimal (IAZ 1873) (Tabelle 2) und vermittelte dorthin im Anschluss an die Weltausstellung als Studenten Dohei Ôgata, der, wie bereits erwähnt, als Dolmetscher Teil der Ausstellungsdelegation war: „Am 9. September stattete eine größere Gesellschaft von Japanesen, welcher der Minister Sano und Professor Wagener angehörten, der Forsthochschule Mariabrunn einen zweiten Besuch ab. Herr Ogata wird sich unter der speciellen Leitung mehrerer Professoren der Mariabrunner Academie dem Studium des Forstwesens widmen. Der genannte japanesische Beamte wird nach der Rückkehr in sein Vaterland bei der Organisation der Forstverwaltung thätig sein“ (LW 1873, S. 593). Sano erkannte die Fortschrittlichkeit der österreichischen Forstwirtschaft und hoffte, durch Ôgata wichtige Erkenntnisse für den Aufbau eines modernen Forstwesens in Japan sammeln zu können.
Auch beabsichtigte Sano, österreichische Forstleute als Experten nach Japan einzuladen, „um dort Holzindustrie und künstliche Holzzucht zu importiren“ (SCHILLING 1875, S. 359), was ihm jedoch mangels seiner fehlenden ministeriellen Zuständigkeit nicht gelang. So wurden stattdessen zunächst die bayerischen Forstbeamten Heinrich Mayr (vgl. END et al. 2023), Eustach Grasman und Karl Hefele als Dozenten für die forstlichen Fächer an die Universität Tokio berufen und erst 1904 wurde mit Amerigo Hofmann ein Forstingenieur aus Österreich nach Japan eingeladen, um den Lehrstuhl für Wildbachverbauung zu besetzen: „Hr. Hoffmann hat sich für die nächsten drei Jahre verpflichtet, in Tokio Forstwissenschaft und die verwandten Fächer an der dortigen Akademie vor Zuhörern zu lehren, die des Deutschen mächtig sind. Die japanische Regierung, im Bewußtsein dessen, daß die Forst- und Terrainverhältnisse in Japan vielfach Ähnlichkeiten mit denen in Österreich aufweisen, legt Gewicht darauf, daß ein versierter Fachmann aus Österreich sich an Ort und Stelle in Japan der Verbesserung des dortigen Forstwesens widme und der Jugend das Neueste auf dem Gebiete der Forsttechnik beibringe“ (ÖFZ 1904, S. 5). Dankesschreiben von Sano an Exner, Marchet und Micklitz für die Aufnahme und Betreuung Ôgatas zeugen von der Wichtigkeit, die Sano der Entwicklung der heimischen Forstwirtschaft beimaß (Anonymous 1875). Sano hatte gezielt Mitglieder der Delegation nach der Ausstellung in Europa belassen und diese in verschiedenen Fachgebieten als sogenannte „technische Studenten“ (gijutsu denshûsei) an Akademien oder in Unternehmen fortbilden lassen, z. B. Bierbrauerei in Pilsen oder Schriftgießerei in Wien, andere Japaner erwarben neue Fertigkeiten in einer Bautischlerei, einer Möbelfabrik und in einer Porzellanmanufaktur (GZ 1873). YOKOI sieht diesen durch Sano beförderten und breit angelegten Wissens- und Kompetenzerwerb als einen wichtigen Entwicklungsschritt Japans hin zu einer Industriegesellschaft (YOKOI 1898).
Im Juli 1874, wenige Wochen vor seiner Rückkehr nach Japan, begab sich Sano zu einem Erholungsurlaub nach Bad Ischl (Ischler Cur-Liste 1874, Welt-Blatt 1874). Dort traf er Anfang August noch einmal Gustav Marchet und sprach mit ihm auch über den Studenten Ôgata. Im Oktober trat der Legationssekretär Koki Watanabe die Nachfolge Sanos an und dieser kehrte nach Japan zurück, wo er im Dezember 1874 eintraf (NFP 1875).
Sano ließ nach seiner Rückkehr eine Sammlung von Berichten zur Weltausstellung in Wien verfassen, die ôkoku tenrankai hôkokusho, in der er wichtige Ergebnisse und in Österreich gesammeltes Wissen veröffentlichte. Darunter befindet sich auch der 10-teilige Band Nr. 4 zur Forstwirtschaft, der zum größten Teil durch Ôgata erstellt wurde (ÔGATA 1875). Es wird hierin jedoch nicht über den forstlichen Teil der Weltausstellung berichtet, sondern es finden sich darin neben einer Übersetzung des österreichischen Forstgesetzes (Teil 8) und der Übersetzung eines Beitrags von Gustav Marchet betreffend die Forsteinrichtung (Teil 3) überwiegend Aufzeichnungen zu forstlichen Themen wie Organisation, Kultivierung, Forstfrevel etc. (Tabelle 3) (vgl. TANAKA & HIRAYAMA 1897).
In diesem offiziellen Bericht erscheint das Protokoll des Gesprächs zwischen Marchet und Sano, das im August 1874 in Bad Ischl stattgefunden hatte, besonders interessant, da durch die stenographische Aufzeichnung der Dialog im Original wiedergegeben wird und somit eine relevante Quelle darstellt. Marchet erörterte darin mit Sano Fragen zur forstwissenschaftlichen Situation in Österreich. Z. B. sprachen sie über die große Relevanz einer nationalen Forstverwaltung oder die Rolle der akademischen, forstwissenschaftlichen Ausbildung, was beides zu diesem Zeitpunkt in Japan noch nicht entwickelt war.
Sanos großes forstliches Engagement ist durch die Entsendung Ôgatas an die Forstakademie und seine frühen Pläne der Gründung einer Forstakademie in Japan sowie Vorhaben zur Entsendung weiterer Japaner zum Studium nach Europa und die Berufung europäischer Forstexperten nach Japan nachweisbar, wenngleich die spätere Umsetzung nicht mehr von ihm verantwortet wurde. Im Juli 1892 wurde er in das Kabinett von Masayoshi Matsukata als Minister für Ackerbau und Handel berufen und stand somit auch der nationalen Forstverwaltung als Minister vor. Fünf Tage nach Amtsantritt versammelte er leitende Forstbeamte und sprach in seiner Antrittsrede über die Rolle der Forstverwaltung. Dabei bezog er sich in seinem Vortrag auch auf seine forstlichen Vorarbeiten zwanzig Jahre zuvor (SANRINKAI 1892). Jedoch wurde bereits drei Wochen später das Kabinett aufgelöst. Sano verlor sein Ministeramt und er konnte seine Ideen und Absichten nicht mehr umsetzen. Seine bis Anfang der 1880er-Jahre relevanten forstlichen Beiträge spielten dann auch später und bis heute in der forstgeschichtlichen Forschung Japans keine Rolle, was bereits INOKUMA (1966) vermerkte. Besonderen Verdienst erwarb sich Sano durch die Gründung der Philanthropischen Gesellschaft, hakuaisha, aus der 1887 die Japanische Rot-Kreuz Gesellschaft hervorging, deren erster Präsident Sano war (MURAKAMI 2004). Ausgezeichnet mit zahlreichen aus- und inländischen Orden und Titeln verstarb Sano 1902 in Tokio.
Dohei Ôgata (1846–1925)
Ôgata wurde 1846 in der Gemeinde Yatamura (Präfektur Okayama) geboren. In Osaka studierte er u. a. rangaku (Hollandwissenschaften), später dazu noch die französische Sprache. 1872 ging er nach Tokio und fand Anstellung beim Organisationsbüro für die Wiener Weltausstellung. Als Dolmetscher für Deutsch verließ er mit dem Großteil der Ausstellungsdelegation im Januar 1873 Japan mit Ziel Wien. Im September 1873 besuchte er mit Sano die Forstakademie in Mariabrunn, an der er nach dem Ende der Ausstellung bei unter anderem Marchet und Exner Forstwissenschaften studierte. Ôgata nahm an Studienreisen und Exkursionen teil, z. B. nach Salzburg oder Dachau (TANAKA & HIRAYAMA 1897). Während einer Studienreise im Sommersemester 1874 für die „Hörer des Industriecurses der k. k. Forsthochschule Mariabrunn“ unter der Leitung von Prof. Exner nach Böhmen zur Besichtigung der holzverarbeitenden Industrie, wurden er und seine Kommilitonen am 02. Juni in Karlsbad von Sano persönlich am Bahnhof in Empfang genommen und verbrachten den Tag mit ihm im Austausch zu forstlichen Themen (SCHILLING 1875). Neben dem Wissenserwerb durch sein Studium an der Forstakademie stand er auch im Austausch mit Vertretern der Landesforstverwaltung, z. B. Oberlandforstmeister Robert Micklitz, der ihm „über den forstlichen Dienstorganismus und seine Thätigkeit“ Auskunft erteilte (Anonymous 1875, S. 53).
Ôgata kehrte im November 1874 nach Japan zurück und wurde in der Forstabteilung des Geographischen Büros beim Innenministerium angestellt, um an der Reorganisation der Staatswälder mitzuwirken (TANAKA & HIRAYAMA 1897). Ôgata war somit der erste japanische Forstbeamte, der nach einem Forststudium in Europa für die Regierung in Japan tätig wurde. Nur ein Jahr später kam mit Hazama Matsuno (1847–1905) ein in Deutschland im Forstfach ausgebildeter Experte zurück nach Japan und fand gleichfalls Anstellung beim Geographischen Büro (YAE 1896; KOBAYASHI 2010). 1876 erfolgte die erste landesweite Waldinventur, deren Planung und Vorbereitung im Wesentlichen durch Ôgata und Matsuno betrieben worden war und einen wichtigen Meilenstein für die Modernisierung der Forstwirtschaft in Japan bedeutete. Maßgeblich beteiligt war Ôgata auch an der Gründung der beiden ersten forstlichen Vereinigungen sanringaku kyôkai (Vereinigung zur Forstwissenschaft) (1880–1882) und der ringaku kyôkai (Gesellschaft der Forstlehre), die beide regelmäßige Vortragstreffen veranstalteten und in eigenen Zeitschriften wissenschaftliche Beiträge, darunter auch Übersetzungen deutschsprachiger Aufsätze, publizierten (NAGAIKE 1975b). Durch die Gründung der dainihon sanrinkai (Japanischer Forstverein) 1882 verloren die beiden erstgenannten Vereinigungen zunehmend an Bedeutung und wurden nach wenigen Jahren aufgelöst. Dass Ôgata nicht zu den Gründungsmitgliedern des japanischen Forstvereins zählte (vgl. SANRINKAI 1882) und auch keine spätere Mitgliedschaft nachweisbar ist, lässt den Schluss zu, dass sein Einfluss und seine Rolle als forstlicher Experte zuvor zunehmend abgenommen hatte. Im September 1880 beendete Ôgata seine Tätigkeit in der Forstabteilung und wechselte in die Finanzabteilung der obersten Regierungsbehörde, wo er vorwiegend mit Übersetzungstätigkeiten betraut war. Ein letzter Hinweis auf seine forstliche Expertise findet sich durch die kurzfristige Berufung als Leiter des großen Forstbezirks Fukuoka, den er aber bereits nach wenigen Wochen wieder verließ, um als Beamter der Präfekturverwaltung in verschiedenen Positionen Karriere zu machen. Während sein ehemaliger Kollege Matsuno (Gründungsdirektor der ersten japanischen Forstpflanzschule in Nishigahara (1878) sowie Direktor der ersten Forstakademie in Tokio, und Gründungsvorstand des Japanischen Forstvereins, der daihinhon sanrinkai (beides 1882) heute als der Pionier der Modernisierung der Forstwissenschaft in Japan gilt, ist die Rolle und Bedeutung Ôgatas weitgehend unbekannt (NAGAIKE 1975a), wenngleich sein forstliches Wirken in den 1870er Jahren und seine zahlreichen Veröffentlichungen in z. B. den ministeriellen Mitteilungsblättern des Innenministeriums die Modernisierung des Forstwesens in Japan entscheidend befeuerten (INOKUMA 1966).
4 Schlussfolgerung
Der ab den 1880er-Jahren deutlich schwindende Einfluss der beiden vorgestellten japanischen Vermittlerfiguren Sano und Ôgata erklärt zumindest in Teilen, warum sich der Fokus von Österreich abkehrte und in der Folge Deutschland das zentrale Land der forstlichen Wissenszirkulation wurde. Eine Vielzahl japanischer Studierender schrieb sich an deutschen Forstfakultäten ein, einige promovierten sogar. Deutsche Forstexperten erhielten von der japanischen Regierung Aufträge als Dozenten und Berater. Erst um die Jahrhundertwende lässt sich ein klarer Trend hin zum Wissensaustausch mit Österreich erkennen, der in einem direkten Zusammenhang mit der neuen Fokussierung auf das forstliche Ingenieurwesen und hierbei vor allem auf die Wildbachverbauung in Japan stand und schließlich mit der Berufung Amerigo Hofmanns das eingangs erwähnte zentrale und sichtbarste Ereignis darstellt. Zahlreiche Japaner studierten ab 1900 forstwissenschaftliche Fächer an der BOKU (Tabelle 4) oder kamen zu Studienreisen nach Österreich-Ungarn.
Ereignisse, von denen die Österreichische Forstzeitung regelmäßig berichtete, z. B.: „Besuch aus Japan in Hallein. Im Auftrage der kaiserlich japanischen Regierung befinden sich derzeit fünf Japaner auf forstlichen Studienreisen in Europa. Einer derselben, der kaiserlich japanischen Forstrath H. Shirasawa, traf aus diesem Anlasse im März d. J. in Hallein ein, und gegenwärtig weilt der Universitätsprofessor aus Tokio, Dr. Shitaro Kawai daselbst. Neben der ärarischen Griesrechenanlage galt sein Besuch dem Schöndorfer Säge-Etablissement, der Cellulosefabrik und der Fachschule, woselbst ihn bei seinem Specialstudium ganz besonders die Werkzeuge der Holzbearbeitung interessierten. Dank der freundlichen Aufnahme, welche der interessante Gast bei den Herren Leitern, bezw. Inhabern der genannten Unternehmungen fand, ist Kawai´s Befriedigung über das hier Gesehene eine volle, und stellte derselbe die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens auch der übrigen drei Herren aus Japan in Hallein in Aussicht“ (ÖFZ 1901), oder auch hier: „Ein Japaner an der Hochschule für Bodencultur. Ein absolvierter Hörer der forstlichen Abtheilung der Universität Toko besucht im heurigen Studienjahre die Hochschule für Bodencultur, wo er die specifisch forstlichen Gegenstände hört. Die weltberühmte vorzügliche Ausbildung der österreichischen Forstbeamten habe ihn, wie er sich äußert, hiezu bewogen. Es scheint, als ob sich die Hochschule für Bodencultur im Auslande einer weit größeren Popularität und Werthschätzung erfreuen würde, als im Inlande“ (ÖFZ 1902, S. 29).
Die Analyse des frühen forstlichen Austauschs von Wissen zeigt, dass die Ausgangslage mit der von Deutschland vergleichbar war. In beiden Ländern hatten erstmals Japaner an forstlichen Fakultäten studiert, offizielle Kontakte waren etabliert und japanische Übersetzungen forstlicher Literatur aus Deutschland und Österreich verfügbar. Es entstand schnell ein personelles Netzwerk und der Austausch zu forstfachlichen Themen nahm zunächst bis ca. 1880 Fahrt auf. Dass bis 1905 nahezu ein Vierteljahrhundert der Austausch mit Österreich jedoch eher verhalten war, kann zu einem Großteil darauf zurückgeführt werden, dass die Vermittlerfiguren dieses Netzwerkes in Japan nicht an den Schlüsselpositionen in den Ministerien und Behörden eingesetzt waren und ihre Interessen somit nur schwer durchsetzen konnten.
Dass die Forstwirtschaft in Österreich aber zumindest doch bis dahin immer auch ein Teil des Wissensaustausches war, ließe sich anhand zahlreicher Beispiele ausarbeiten. Zu nennen wären dabei vor allem die Studienreise des Direktors der Japanischen Forstbehörde Morimasa Takei an die BOKU 1885 (Die Presse 1885), die erste Teilnahme eines japanischen Forstwissenschaftlers an einer Forstversammlung in Österreich 1888 durch Shiga Taizan, Professor an der Forstakademie Tokio (ÖVF 1888), oder die Studienreise des kaiserlichen Forstbeamten Shigeharu Murata 1900. Die Analyse dieses zeitlichen Zwischenraumes würde die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der forstlichen Wissenszirkulation zwischen Japan und Österreich komplettieren. Auch eine Analyse der qualitativen und quantitativen Entwicklung der internationalen forstlichen Ausstellungsbeiträge Japans, z. B. Paris (1878), Edinburgh (1884), Chicago (1893) und wiederum Paris (1900) könnte deutlich machen, dass die Weltausstellung in Wien als Initialereignis eine wichtige Wegmarke darstellt.
Danksagung
Die Autoren danken dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK-BW) sowie dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für die Realisation dieser forsthistorischen Forschung im Rahmen der Projekte „KoWald 1+2“ (MWK-BW) sowie „3Pfeile“ (BMEL).
Literatur
ANTOINE, F. (1876a) Das Pflanzenreich auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 (Fortsetzung). In: Oesterreichische Botanische Zeitschrift. XXVI. Jahrgang. No. 7, 241-243.
ANTOINE, F. (1876b) Das Pflanzenreich auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 (Fortsetzung). In: Oesterreichische Botanische Zeitschrift. XXVI. Jahrgang. No. 8, 271-277.
AULITZKY, H. (1984) Das Institut für Wildbach- und Lawinenverbauung an der Universität für Bodenkultur in Wien. In: Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Band 101, 2, 65-81
Anonymous (1875) Mittheilungen. In: Centralblatt für das gesamte Forstwesen. 1. Jahrgang. S. 53
CIJ (Commission Imperiale Japonaise ) (1873) Mémoire des travaux des commissions au Japon. In: Commission Imperiale Japonaise (Hg.). Yokohama. 49-64
CLF (Congress der Land- und Forstwirthe) (1874) Stenographische Protokolle des ersten internationalen Congresses der Land- und Forstwirthe. Faesy & Frick. Wien.
DEPKAT, V. (2014) Autobiografie und Biografie im Zeichen des Cultural Turn. In: Jahrbuch für Politik und Geschichte 5, 247-265
Die Presse (1885) Japanesen in Wien. In: Die Presse. Beilage zu Nr. 9. 38. Jahrgang. 09.01.1885. S. 9
DUPONT, E. (1880) Les Essences Forestieres Du Japon. Paris. Berger – Levrault. 170 S.
END, C; YAMAMOTO, S.; S. HEIN (2023) Forestry Knowledge Circulation - -Dr. Heinrich Mayr and silvicultures in early modern Japan. In: Journal of Forest Economics. (im Druck)
ETZELMÜLLER, T. (2012): Biographien. Frankfurt. 195 S.
EXNER, F. (1872) Die Werkzeuge des Scheiners in China und Japan. Eine technologische Studie. In: SCHERZER, K. (Hrsg.) Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan (1868-1871). Stuttgart. 320-339
EXNER, W. (1881a) Japans Holz-Industrie. In: Österreichische Monatsschrift für den Orient. Nr. 4. 55-58
EXNER, W. (1881b) Japans Holz-Industrie (Fortsetzung). In: Österreichische Monatsschrift für den Orient. Nr. 5. 82-85
EXNER, W. (1881c) Japans Holz-Industrie (Fortsetzung). In: Österreichische Monatsschrift für den Orient. Nr. 7. 118-119
EXNER, W. (1874) Die Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung. In: K.k. Ackerbau-Ministerium (Hg.) Die Bodencultur auf der Wiener Weltausstellung 1873. Zweiter Band. Das Forstwesen. Faesy & Frick, Wien. 105-190
EXNER, W. (1929) Erlebnisse. Springer Verlag, Berlin. 256 S.
FISCHBACH, C. (1874) Bericht über den internationalen Congreß der Land- und Forstwirthe in Wien 1873. In: Monatsschrift für das Forst- und Jagdwesen. 49-64
FRIEDRICH, J. (1893) Internationaler Verband forstlicher Versuchsanstalten. In: Centralblatt für das gesamte Forstwesen. 19. Jahrgang. 383-386
GD (General-Direction) (1873a) Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Officieller General-Catalog. Verlag der General-Direction. Wien
GD (General-Direction) (1873b) Amtliches Verzeichniss der Aussteller, welchen von der internationalen Jury Ehrenpreise zuerkannt worden sind: Weltausstellung 1873 in Wien. Verlag der General-Direction. Wien. 572 S.
GZ (Gemeinde-Zeitung) (1873) Studien der Japaner in Österreich. In: Gemeinde-Zeitung. 14. September 1873. S. 3.
HEDINGER, D. (2011) im Wettstreit mit dem Westen. Japans Zeitalter der Ausstellungen 1854-1941.Frankfurt, 426 S.
HOFMANN, A. (1913) Aus den Waldungen des fernen Ostens. Wilhelm Frick. Wien. 225 S.
IAZ (Internationale Ausstellungs-Zeitung) (1873a) Forstliche Ausstellungen. In: Internationale Ausstellungs-Zeitung. 24.07.1873. S. 3
IAZ (1873b) Ausflug der Japaner. In: Internationale Ausstellungs-Zeitung. 31. Juli 1873. S. 4
INOKUMA, T. (1966) sano tsunetami no sanrinkansei shushihôkokusho to ôgata dohei no sanrin jiseki (Report zur Forstorganisation von Sano Tsunetami und forstliche Spuren des Ôgata Dohei) Japanisch. In: The reference. Jahrgang 16. Band 4. 7-18.
Ischler Cur-Liste (1874) Nr. 13. (https://anno.onb.ac.at)
JAC (Japanische Ausstellungs-Commission) (1873) Catalog der Kaiserlich Japanischen Ausstellung. Verlag der Japanischen Ausstellungs-Commission. Wien. 151 S.
JACAR (Japan Center for Asian Historical Records) A15113482500, bankoku ringyôshikenjôkumia ni kanyû (Beitritt zum internationalen Verband forstlicher Versuchsstationen) Japanisch. In: Japan Center for Asian Historical Records (JACAR) Ref.A15113482500, Traffic, communications, and ships and vehicles; geography, land, and forest, and weather observation; police; temples and shrines; relief fund for injured or killed law enforcement personnel, Kobun Ruishu, 27th Compilation, Vol. 15 (1903) (National Archives of Japan)
JOHANN, E.; BUCK, A.; BURGER, B.; KLEINE, M.; PRÜLLER, R.; WOLFRUM, G. (2017) 125 Years of IUFRO. History of the International Union of Forest Research Organizations 1892-2017. Wien. 128 S.
JUDEICH, J. (1874) Land- und Forstwirthschaft. In: Centralcommission des deutschen Reiches (Hg.) Amtlicher Bericht über die Weltausstellung im Jahre 1873. Zweiter Band. Braunschweig. Vieweg und Sohn. 673-748
KOBAYASHI, F. (2010) meiji no roman matsuno hazama to matsuno kurara (Hasama Matsuno und Klara Matsuno – ein Meiji Roman) Japanisch. Ozora. Tokio. 190 S.
KREINER, J. (1976) Japanforschung in Österreich. Wien. 413 S.
LANMAN, C. (1883) Leading men of Japan. Boston. 421 S.
LECKIE, S. (2004) Biography Matters. Why Historians Need Well-Crafted Biographies More Than Ever. In: LLOYD E. (Hg): Writing Biography. Historians and Their Craft, Lincoln, NE, 1-26.
LIGHTMAN, B., G. MCOUT und L. STEWART (Hg.) (2013): The Circulation of Knowledge between Britain, India and China. London. 339 S.
LORENZ-LIBURNAU, H. v. (1896) Über die Forstwirtschaft Japans. In: Österreichische Vierteljahrschrift für Forstwesen. 14. Jahrgang. S. 190-193
LOTZ, C. (2018) Nachhaltigkeit neu skalieren. Köln. 359 S.
LÜSEBRINK, H. (2001) Kulturtransfer – methodisches Modell und Anwendungsperspektiven. In: TÖMMEL, I. (Hg.) Europäische Integration als Prozess von Angleichung und Differenzierung. 213-226
LW (Leitmeritzer Wochenblatt) (1873) Studien der Japanesen in Oesterreich. In: Leitmeritzer Wochenblatt, 01.10.1873, S. 593
MICKLITZ, R. (1874) Die Forstwirtschaft. In: K.k. Ackerbau-Ministerium (Hg.) Die Bodencultur auf der Wiener Weltausstellung 1873. Zweiter Band. Das Forstwesen. Wien. Faesy & Frick, 1-101
MOSER, M. (1872) Fotoalbum mit Exponaten des japanischen Pavillons auf der Weltausstellung 1873. Österreichische Nationalbibliothek. Signatur Sk3239, 5 POR MAG
MURAKAMI, M. (2004) nihon akajisha no setsuritsukata, sano tsunetami (Sano Tsunetami, Gründer des japanischen Roten Kreuz) Japanisch. In: Structure and Function. Volume 2 (2003-2004), 35-38
NAGAIKE T. (1975a) matsuno hazama to ôgata dôhei jô (Matsuno Hazama und Ôgata Dohei, Teil 1) Japanisch. In: Forest Economy. Jahrgang 28, Nummer 10. 16-25. DOI: https://doi.org/10.19013/rinrin.28.10_16
NAGAIKE T. (1975b) matsuno hazama to ôgata dôhei ka (Matsuno Hazama und Ôgata Dohei, Teil 2) Japanisch. In: Forest Economy. Jahrgang 28, Nummer 11. 11-17. DOI: https://doi.org/10.19013/rinrin.28.11_11
NFP (Neue Freie Presse) (1875) Personal-Nachrichten. In: Neue Freie Presse. Nr. 3762. S.1
NFP (1913) “Aus den Waldungen des fernen Ostens”. In: Neue Freie Presse. Nr. 17677. 40-41
NIZ (Neue Illustrierte Zeitung) (1874), II. Band. Nummer 32. S.11
NISHIMOTO, H. (2018) Condition of the education on SABO in the incipient period of modern SABO. Japanisch. In: Sabogakushi. Vol 70. No. 5, S. 15-23
ÖFZ (Österreichische Forstzeitung) (1901) Besuch aus Japan in Hallein. In: Österreichische Forst-Zeitung. 19. Jahrgang. Nr. 31. S. 5
ÖFZ (1902) Ein Japaner an der Hochschule für Bodencultur. In: Oesterrreichische Forst- und Jagdzeitung. 20. Jahrgang. Nr. 4. S. 29
ÖFZ (1904) Berufung eines österreichischen Forsttechnikers nach Japan. In: Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung. 22. Jahrgang. Nr. 6. S. 45
ÖFZ (1916) Dr. Gustav Marchet. In: Österreichische Forst- und Jagd-Zeitung. 34. Jahrgang. Nr. 18. 1-2
ÖVF (Österreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen) (1888) Die 31. Generalversammlung des Forstvereins für Oesterreich ob der Enns. In: Österreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen. VI. Band. S. 254-257
ÔGATA, D. (1875) ôkoku tenrankai hôkokusho sanrinbu (Bereicht zur Weltausstellung in Österreich – Teil zur Forstwirtschaft). Japanisch. Ôkukutenrainkai jimukyoku (Hg.) (Büro zur Weltausstellung in Österreich. Tokio.
PANTZER, P. (1973) Japans Weg nach Wien – Auftakt und Folgen. In: FUX, H. (Hg.) Japan auf der Weltausstellung in Wien 1873. Wien, 98 S.
REIN, J. (1881) Japan nach Reisen und Studien. Band 1. Leipzig. Engelmann. 618 S.
SAKAMOTO, H. (2007) Relationship between the Japanese Exhibits at the Philadelphia International Exhibition of 1876 and the Vienna World Exhibition of 1873. Japanisch. In: The 54th Annual Conference of JSSD. DOI: https://doi.org/10.11247/jssd.54.0.B07.0, 15 S.
SANRINKAI (1882) senkyokai (Vorstandswahlen) Japanisch. In: sanrin. Band 1. 6-7
SANRINKAI (1892) sano nôshômudijin no enzetsu (Rede von Ackerbauminister Sano) Japanisch. In: sanrin. Band 115. 50-51
SARASIN, P. (2011): Was ist Wissensgeschichte? In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Vol. 36, No. 1, 159-172
SCHILLING, C. (1875) Studienreise der Hörer des Industriecurses der k. k. Forsthochschule Mariabrunn (Schluß). In: Centralblatt für das gesamte Forstwesen. 1. Jahrgang. 355-364
SCHWEIGER, H. (2009): Biographiewürdigkeit. In: KLEIN, C. (Hg.): Handbuch Biographie: Methoden, Tradition, Theorien. Stuttgart. 32-36
STAHNCKE, H. (2000) Preußens Weg nach Japan. Japan in den Berichten von Mitgliedern der preußischen Ostasienexpedition 1860-61. München. Iudicum. 262 S.
SYRSKI, S. (1872) Landwirthschaft in Japan. In: SCHERZER, K. (Hg.) Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan. Stuttgart. Julius Maier Verlag. 175-227
SYRUCZEK, E. (1853) Das Forstgesetz vom 3. Dezember 1852 und die bestehenden Jagd-Gesetze. Rumburg. 108 S.
TANAKA, F. und S. HIRAYAMA (1897) ôkoku hakurankai sandô kiyô (Aufzeichnungen zur Teilnahme an der Weltausstellung in Österreich). Japanisch. Tokio. 215 S.
Welt-Blatt (1874) Der japanische Ministerresident. Jahrgang 1874. Nr. 175. S.
WWZ (1873) (Wiener Weltausstellungs-Zeitung) Nr. 267, Ausgabe vom 02.10.1873, S.3
WZ (Wiener Zeitung) (1873) Weltausstellung 1873 in Wien. In: Wiener Zeitung, Nr. 95. Ausgabe vom 23.04.1873, S. 395
YAE, M. (1896) meiji ringyô no hottan (Der Ursprung der Meiji- Forstwirtschaft) Japanisch. In: sanrin. Band. 157. S. 14-36
YOKOI, T. (1898) nihon kôgyôshi (Die Industriegeschichte Japans). Japanisch. Tokio. 360 S.
ZWANZIGER, G. (1874) Thiere, Pflanzen und Steine auf der Weltausstellung. VIII. China, Formosa, Philippinen. – Japan, Siam, Hawai. In: Carinthia I-64: 292-300